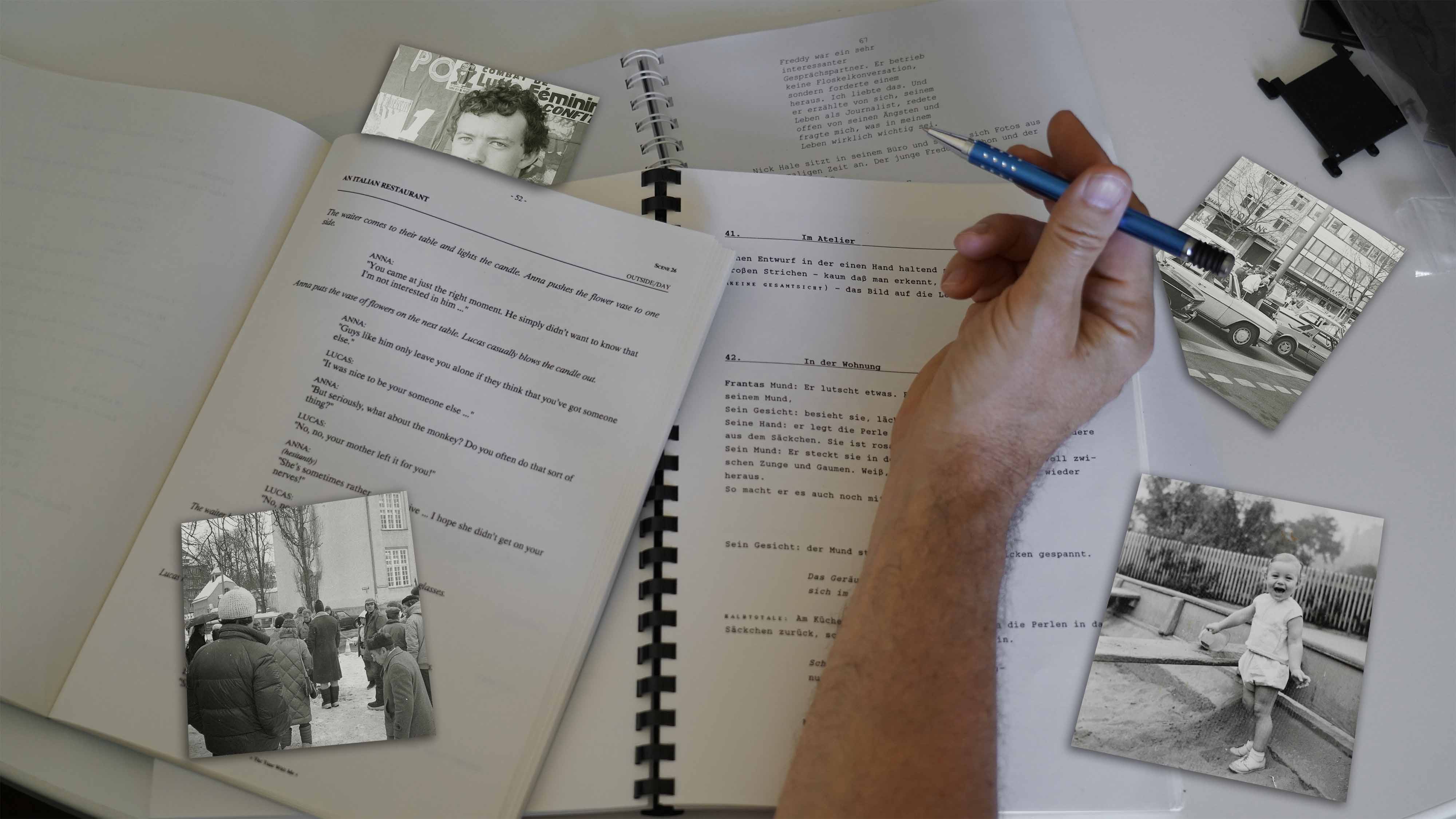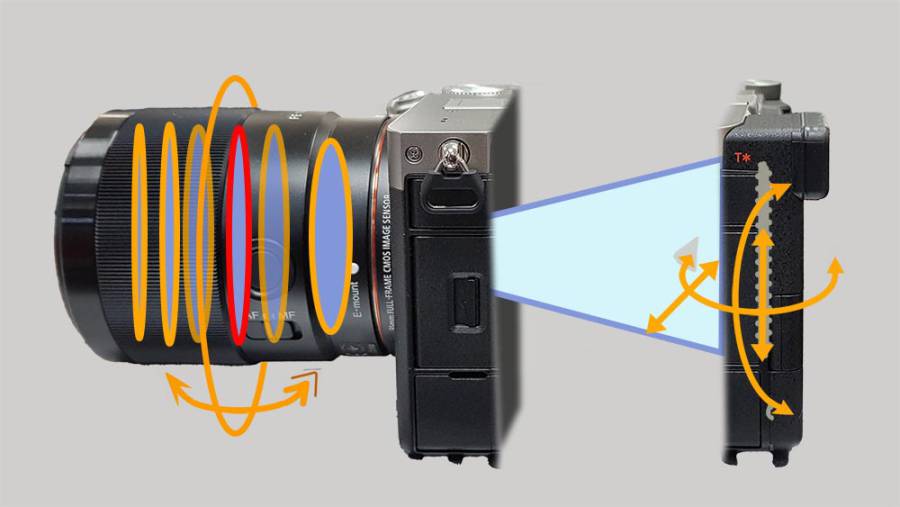Das "Ich" als Geschichtenfundus
Sollte man, darf man, muss man vielleicht sogar perönliche Erlebnisse in Drehbüchern verwenden? Ja unbedingt! Geschichten erzählen hat so gut wie immer auch mit der eigenen Person zu tun. Das Bedürfnis, überhaupt Geschichten zu erzählen, erwächst zumeist aus dem Wunsch, sich mitzuteilen. Deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen eigene Erlebnisse, Erfahrungen aber auch Enttäuschungen und Verletzungen auf kreative Weise weitergeben wollen. Drehbuchautor*Innen und Regisseur*Innen tun dies häufig schon bei ihren ersten Arbeiten. Man denke nur an Francois Truffaut, der in seinem "Sie küssten und sie schlugen ihn" / "Les Quatre Cents Coups" (F 1959) seine eigene schwierige Kindheit filmisch verarbeitet hat. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Truffaut hier am Anfang Erwähnung findet, schließlich waren es die Regisseure der Nouvelle Vague, welche den Drehbuch- schreibenden Filmemacher, den Autorenfilmer, erst in die Kinos hinein gebracht haben.
Der Schwedische Regie-Altmeister und Autor intensiver psychologischer Dramen, Ingmar Bergmann hat viele persönliche Erinnerungen, Obsessionen und Albträume zu Filmen verarbeitet. Durch seine besondere Art der Stilisierung und eine kompromisslose Dramatisierung wurden daraus filmische Meisterwerke. Beispiele hierfür sind "Lächeln einer Sommernacht " (Schweden 1955), "Jungfrauenquelle" (Schweden 1959) oder "Persona" (Schweden1966).
Bemerkenswert seine Fähigkeit, das persönlich Erfahrene zu übersetzen in archetypische Situationen über Verlassenheit, Schuld und Sühne. Damit eröffnete er diese eigenen Grundbefindlichkeiten allen Zuschauern seiner Filme. Dieser Kunstgriff erlaubt es, auch sein eigenes Ich in Filme einfließen zu lassen.
Kenneth Branaghs hat in seinem Film "Belfast" (GB 2021), der Geschichte eines Neunjährigen Jungen in Nordirland zum Ende der 1960er, eigene Erlebnisse verarbeitet. In „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ (USA 2020) erzählt Lee Isaac Chung die Einwanderergeschichte seiner südkoreanischen Familie in den 80er-Jahren auf dem Land in Arkansas. Steven Spielberg hat in „The Fabelmans“ (USA 2022) seine Kindheit und das Leben seiner Eltern filmisch aufgearbeitet.
Und natürlich der großartige britische Regisseur Terence Davies, der in seinen ersten Filmen "Distant Voices, Still Lives“ (1988) und "The Long Day Closes“ (1992) –, seine eigene furchtbare Kindheit und Jugend im Liverpool der Vierziger- und Fünfzigerjahre verarbeitet hat. Tatsächlich kann man sogar sagen, dass der Autodidakt durch den Film all die Schrecklichkeiten unter anderem eines prügelnden Vaters, erst hat verarbeiten können. Dass seine Filme eine solche Eindrücklichkeit hatten, verdanken sie dem autobiographischen Hintergrund. Bei Davies kann man sogar eine regelrechte Teilung seines filmischen Werkes beobachten. Mit den ersten Filmen musste er seine eigene furchtbare Kindheit verarbeiten, die Leiden quasi aus dem Weg schaffen, damit dann Platz für freie außerhalb seiner Biographie liegende Stoffe entstehen konnte.
Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Wir alle tragen Geschichten in uns und weil wir diese selbst erlebt haben, kennen wir uns natürlich mit dem Stoff auch besonders gut aus. Deshalb macht es Sinn, diese auch in Drehbüchern zu verarbeiten oder zumindest Elemente daraus in die Drehbücher einfließen zu lassen. Im Grund genommen sind die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen sogar die Grundlage für alle Autor*Innen, ganz gleich ob es sich um Romane, Kurzgeschichten, Gedichte oder eben um Drehbücher handelt. Doch genau hier liegen eben auch bedeutsame Unterschiede Fallstricke und Chancen.
Ein Gefühl ist noch lange kein Film...
Eigene Erlebnisse, autobiografische Inhalte dürfen durchaus eine Inspirationsquelle sein. Wichtige Voraussetzung dafür ist aber, dass man sich aus den Fesseln der eigenen Betroffenheit befreien kann. Das größte Problem ist nämlich, dass man selbst die Emotionen, die man in Zusammenhang mit den tatsächlichen Geschehnissen hatte, noch immer deutlich fühlt und deshalb davon ausgeht, dass die Zuschauer des Filmes, das genau so empfinden. Doch damit Zuschauer emotional in eine Geschichte einsteigen können, braucht es mehr. Das Festhalten an den tatsächlichen Ereignissen kann daher auch ein erzählerisches Gefängnis sein.
Filme werden manchmal benutzt zur Reflektion über die eigene Lebenssituation, zur Bewältigung von eigenem Unglück oder eigener Sorgen, zum Wehklagen in Drehhbuchzeilen und Filmbildern. Doch all das schließt die Zuschauer häufig aus. Nur wer die eigene Geschichte neu und anders erzählt, wer sie selbstkritisch, humorvoll, ironisch oder auch mal schmerzhaft aber eben anders als real geschehen erzählt, hat sich von ihr gelöst und kann sie dramaturgisch optimal vermitteln. Wer sklavisch an den tatsächlichen Abläufen festhält, engt sich erzählerisch enorm ein und, kann keine neuen, freien Gedanken entwickeln.
Man sollte also bereit sein, die Geschichte so zu erzählen, dass sie für ein filmisches Erlebnis optimal ist. Das kann bedeuten, dass man vieles weglässt, anderes dazuerfindet,- dass man so schreibt, wie es für den Film gut ist und nicht, wie es "wirklich gewesen ist". Reale Ereignisse, noch dazu gefiltert in unserer eigenen Erinnerung sind nicht automatisch filmtauglich. Vielleicht sind es aber bestimmte Teile daraus, bestimmte Aspekte und Momente, welche man sehr gut in ein Drehbuch mit aufnehmen kann.
Wer also die Kraft aufbringt, nicht an den Tatsachen, den erinnerten Abläufen festzuhalten, sondern die Kernelemente wenn sie filmtauglich sind, verwendet und andere Dinge bereit ist aufzugeben und durch erfundene oder die realen Elemente anderer Situationen oder aus der Erinnerung anderer Menschen zu ersetzen, der hat gute Chancen, daraus starke Drehbücher werden zu lassen. Ein guter Ausgangspunkt für ein Drehbuch kann es sein, in der eigenen Biografie zu recherchieren und dabei Geschichten oder Skizzen zu finden, die für das geplante Drehbuch geeignet sein könnten. Zugleich besteht aber auch die Notwendigkeit, zu fiktionalisieren. Will sagen, das Eigene und das recherchierte Fremde ergeben, durch den eigenen Kopf gefiltert, gemeinsam die perfekte Grundlage für ein gutes Drehbuch.
Erinnerte Personen
Vieles, was wir für starke Personen im Drehbuch gebrauchen könnten, ist in unserem Unterbewusstsein verborgen. Manchmal sind es nur Gedanken und Erinnerungen, manchmal sind es aber auch alte Fotos oder auch Videos, welche in einem Erinnerungen an bestimmte Personen wieder wach werden lassen. Starke Drehbücher brauchen starke Haupt,- und Nebenfiguren, also Charaktere, die glaubwürdig und interessant sind. Filmheld*Innen werden interessanter durch Besonderheiten und durch großartige , ungewöhnliche Gegenspieler*Innen. Hier können einem die Menschen, die einem in Erinnerung geblieben sind, hervorragend als Vorbild dienen, um deren Eigenschaften, Aussehen und Charakter auf Filmfiguren zu übertragen. Das hilft nicht nur bei der Beschreibung der Figuren und der Formung eines Charakters, sondern auch um zu erspüren, auf welche Art und Weise diese ihre Dialoge formulieren würden. All das sollte man natürlich durch Recherche und Beobachtungen ergänzen, je reicher der Ideenfundus eines Drehbuchs ist, desto überzeugender wird auch der daraus resultierende Film.
Eigene Erlebnisse sind also durchaus etwas Kostbares, ein reicher Fundus für die eigene Drehbuch,- und Filmarbeit, wenn man bereit ist, sich vom exakten Nachbauen des Erlebten zu lösen und Kernelemente mit anderen, optimierten Story-Elementen zu verknüpfen.