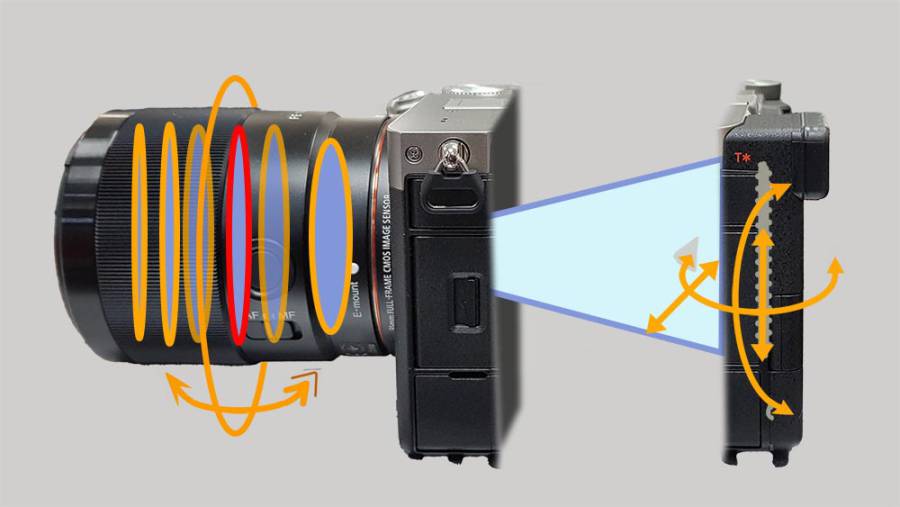Philippe Dériaz schreibt seit Jahren für die Zeitschrift "Kameramann". Er war Aufnahmeleiter der erfolgreichen deutsch-schweizerischen Koproduktion "Es geschah am hellichten Tag", verfilmt 1958 mit Heinz Rühmann, Michel Simon und Gert Fröbe. 1958 koordinierte der Schweizer als Regieassistent die Massenszenen der schweizerischen Produktion "Taxichauffeur Bänz".
Geboren 1930 in Genf, beschäftigt sich der gelernte Ingenieur seit seiner Jugend mit Sprache und Film. Bis heute berichtet der französische Muttersprachler vor Ort von allen renommierten Filmfestspielen in der Schweiz, Deutschland und Österreich.
Philippe Dériaz' berufliches Schaffen erscheint universell, so weitreichend ist sein Spektrum an Arbeiten für den Film. Er erlernte das Filmhandwerk "von der Pike auf". Aus der Rückblende betrachtet, versteht der aktive 85-Jährige diese entbehrungsreiche Lebensphase als solide Reifezeit für nennenswerte Leistung.
Interview
R.K. Wie kamen Sie zum Film und wurden, darf ich Sie so nennen, ein leidenschaftlicher Filmjournalist?
Ph.D. Der Leser – vermutlich viel jünger als ich – wird sich bestimmt über manches in dieser « Wegbeschreibung » wundern : er möchte aber (bitte) den historischen Abstand berücksichtigen.
In meiner Kindheit – also vor dem Krieg – war bei uns Kinobesuch gar nicht üblich; gewiss, Disneys Schneewittchen haben wir angeschaut, als es in Genf herauskam, doch blieb es eine Ausnahme und beeindruckte mich nicht. Meine Interessen entwickelten sich in der Gymnasialzeit anders: Theater (auf der Bühne zu stehen, ein Traum!), dann Literatur (Poesie besonders), später kam die Musik hinzu (nur passiv, als Hörer, viel am Radio); ins Kino zog mich wenig, es war sicher eine Prise Hochmut dabei. Fürs Abitur galt’s, Latein und Griechisch zu büffeln; Deutsch war mir zuwider, bis mir Rilkes Cornet offenbart wurde; die besten Noten ergaben die französischen Aufsätze – Schreiben als Leidenschaft (oder Krätze, Juckreiz). Erster Haken in meinem Lebenslauf: ich unternahm, Chemie zu studieren, und zog deshalb nach Zürich zur Eidgenössischen Technischen Hochschule.
Mehr oder weniger zufällig entdeckte ich die Macht des Kinos: durch eine Vorführung von Les visiteurs du soir (Marcel Carné 1942), da war mit der distanzierten Haltung Schluss. Das Werk überwältigte mich, vorerst zwar auf inhaltlicher und literarischer Art; ich fing an, Filme öfter anzuschauen und darüber nachzudenken. Es gab weitere schockartig erleuchtende Erlebnisse, z.B. Louisiana Story (Robert Flaherty 1948). Meine endgültige Bekehrung schaffte Orphée (Jean Cocteau 1949); da erkannte ich, dass manches ausgedrückt wurde, was nicht in Worten erfassbar und mitteilbar wäre, selbst für einen Sprachakrobat wie Cocteau: der Film war dazu erforderlich, errang damit eigenen Kunststatus.
Die nächste Offenbarung war Das Testament des Dr. Mabuse (Fritz Lang 1932), denn die Krimihandlung (so empfand ich sie) stellte die fabelhaften Übergänge und die spezifisch filmischen Mittel Bild und Schnitt scharf heraus – der Film als Artefakt sui generis. In dieser Reihe folgten, beinahe selbstverständlich, Der letzte Mann (Friedrich-Wilhelm Murnau 1924), Panzerkreuzer Potemkin (Sergej Eisenstein 1925), Dies irae (Carl Theodor Dreyer 1943).
Der Filmklub verhalf uns zu Kenntnissen in Filmgeschichte, und ich besuchte immer häufiger die Zürcher Kinos, verschlang Unmengen Streifen aller Arten. Streckenweise widmete ich mehr Fleiß dem Film als meinem technisch-wissenschaftlichen Studium! Und immer weiter überlegte ich, untersuchte, wodurch Kino wirkt, suchte, was in einem Leinwanderzeugnis wahrlich Film ist, in was eben Filmwesen besteht. Und fühlte immer mehr Lust, immer mehr Drang, meine Erkenntnisse anzuwenden, also selber Filme zu drehen.
Trotz dieser mächtigen Ablenkung wurde mir schließlich das Diplom eines Chemiker-Ingenieurs ETH erteilt – und diesem Beruf kehrte ich gleich den Rücken, beschloss, beim Film (und Theater) zu arbeiten. Wieder muss man die damaligen Umstände berücksichtigen. Filmhochschulen gab es kaum; eine einzige war mir bekannt, die IDHEC in Paris, und ich wusste von der Aufnahmealtersgrenze bei 25 Jahren, die ich gerade erreicht hatte. Zürich war in der Schweiz der einzige Ort, wo etwas wie eine Filmwirtschaft bestand, und in Zürich hatte ich mit der Zeit im Filmklub und in filminteressierten Hochschulkreisen ein paar Leute aus der tatsächlichen Praxis kennen gelernt. Also fing ich an, wo ich halt war, fing an, mich vorzustellen und zu bewerben – schlicht für alles! Denn in der damals recht kleinen Schweizer, also Zürcher Filmfachwelt galt es aller ersten, keine der ohnehin eher seltenen Arbeitsmöglichkeiten abzulehnen.
Auch über die Ausrüstung kurz nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts würden die Leser, die heutigen Fachmänner und –frauen, Filmstudenten oder –schaffenden staunen. Die Geräte waren in der Mehrzahl schwer, dafür stand- und stoßfest. Die Sicherheitsvorkehrungen meistens unterentwickelt. Je nach Firma war die Gerätschaft noch beinahe vorsintflutlich: mächtige Bratpfannen als Scheinwerfer, mit riesigen Glühbirnen, die zum Transport in Sonderholzgestellen aufgehängt wurden. Den Umgang mit Beleuchtungskörpern hatte ich beim Studententheater schon ausprobiert.
Ich lernte die gebräuchlichen Kameras kennen: die ratternde Arriflex mit Stahlgussgehäuse, der kleine Kasten Debrie Parvo (mit fabelhaften Bildstand) und die große Kiste Super Parvo für geräuschlose Aufnahmen – alle nur mit auswechselbaren festen Brennweiten. Je nach Kameratyp musste der Rohfilm anders – Schicht außen oder Schicht innen – gerollt sein. Die Norm war 35mm, 16 galt als Amateurformat, gerade für das keimende Fernsehen noch gut. Die Materialkosten (Rohfilm + Entwicklung + Kopien) waren beträchtlich, auch im Verhältnis zu den Arbeitskosten (bei denen leichter zu sparen war...). Die Arbeitskopie wurde nass geklebt, eine heikle Arbeit mit etlichen Folgen. Bei jedem Arbeitsschritt also herrschte die Notwendigkeit, genau zu überlegen und erst dann zu handeln.
Als Gehilfe übernahm ich mannigfaltige Aufgaben, schleppte Lampen und Kabel, schob das Wägelchen bei Kamerafahrten, zog Schärfe und Blende (nichts lief automatisch), plante Außenaufnahmen, fragte nach Hotelzimmern, besorgte Kleindarsteller, gegebenenfalls dolmetschte ich, übersetzte Drehbücher und bearbeitete Treatments – nur ja nichts auslassen, was mit Film zu tun hatte! Und auch nicht aufhören, über all das nachzudenken, jede Kenntnis in mein „kritisches Fachbuch“ einzubauen. So erfuhr ich Schritt nach Schritt, was zur Fertigung meiner Wunschbilder notwendig ist, lernte Anschlüsse, Achsen, Überlappungen, Zeitüberbrückungen, korrigierte meine naiven Vorstellungen sowie hinterfragte (innerlich!) einige tradierte Arbeits- und Gestaltungsweisen. Kurz: ich bildete mir ein Handwerk, gewann Mittel, um meine Ansichten zu verwirklichen.
Theorie und Praxis...
Dass die Reihenfolge der Einstellungen – in ihren Form-, Größen- und Dauerverhältnissen – maßgebend, ja wesentlich ist, war mir schon vor der Leinwand bewusst geworden; aber schlichtes Handwerk ist am Schneidetisch erforderlich, besonders beim damaligen technischen Stand. Bei einem Produzenten warteten im Schneideraum mehrere Körbe auf Abholung, mit einem Wust von Ausschnitten voll, die die Müllabfuhr so ablehnte; also wurde ich beauftragt, daraus artige kompakte Rollen zusammenzuhängen, so übte ich tagelang, mit Hobel und Kitt umzugehen – und konnte es dann. Da lagen auch viele Büchsen mit unverarbeiteten Aufnahmen von Baustellen, für einen zukünftigen Film entstanden, jedoch ohne Plan oder Drehbuch; ich las die Unterlagen der auftraggebenden Firma und überlegte, wie man die ganze Angelegenheit gliedern könnte – und man ließ mich gewähren! Ich bastelte (mit Leidenschaft und manchen übertriebenen Überlegungen) Filme aus dem vorhandenen Material, schlug auch noch ergänzende Aufnahmen vor. Dieses Gestalten – beinahe Kneten! – von gegebenen Bildern, die keineswegs meiner eigenen Phantasie entstammten, erwies sich als wichtige Schulung.
Jener Schneidetisch, auf dem ich mich austobte, besaß nicht einmal einen Magnettonkopf! Das war aber nicht besonders hinderlich, denn damals (und noch lange) wurden Auftragsfilme stumm gedreht, erst der fertige, abgenommene Schnitt wurde mit Musik und Kommentar versehen. In der mehrsprachigen Schweiz war es ohnehin wichtig (sogar für die Werbung!), den O-Ton, die direkte, an den Lippen sichtbare Sprache zu umgehen. Das begann schon beim Konzept eines jeden Films, und davon musste ich etliche entwerfen und bis zum Drehbuch entwickeln. Diese eidgenössische Akrobatik bildete eine wertvolle Schule, um eine Handlung solchen Zwängen entsprechend zu erfinden, um in Einstellungen und Schnitten zu denken; diese Erfahrung halte ich heute noch für unbezahlbar. Und mir ging es nicht darum, mich in eigenen Geschichten auszudrücken, sondern meine Filmsprache auf die Leinwand zu werfen; daher war’s gleichgültig, Spiel-, Industrie- oder Werbefilme zu gestalten: Film ist Film.

Es geschah, dass ein Produzent, bei dem ich öfter schuftete, eine prinzipielle Abmachung mit einem Kunden für einen Image-Film hatte, aber der Kunde lehnte ein Drehbuch nach dem anderen ab und wusste eigentlich selber nicht, was er wollte. Es wurden mit der Zeit mehrere Vorschläge ausgearbeitet, auch ich entwarf (aus eigenem Antrieb) ein ziemlich ausgefallenes Projekt, das ebenfalls scheiterte. Dieses Drehbuch enthielt, wie es damals Brauch und Pflicht war, jede einzelne Einstellung in genauer Beschreibung. Einmal saß ich neben dem leicht verzweifelten Chef vor einem Gremium des Auftraggebers, hörte, was unklar den Leuten vorschwebte, bat dann um Erlaubnis, meine Idee nochmals vorzustellen – und sie gefiel, wurde angenommen! Vielleicht, weil ich sie mit Überzeugung vortrug, vielleicht weil sie schon genau durchgearbeitet war. Vielleicht, weil ich für jede Spielszene bekannte, beliebte Kabarettisten und Volksschauspieler vorgesehen hatte. Sogar die dadurch verursachte Verteuerung wurde gutgeheißen (was den Produzenten freute, denn dadurch erhöhte sich sein Gewinn). So ging die Sache in Produktion und, nach einem bitteren Streit mit dem Produzenten, durfte ich meinen Plan selbst ausführen, meinen ersten Film drehen – ohne richtige Erfahrung, nur mit den Mitteln meiner langen Überlegungen. (Das gut halbstündige Werk ist heute verschollen.) Hiermit ward ich Regisseur. Das Weitere ist eine andere Geschichte.
Heute (das heißt: ungefähr seit zwanzig Jahren) schreibe ich nur noch, um den Film, über Filme. Es ist aber keine „Ersatzhandlung“, denn geschrieben habe ich immer, diese Ausdrucksweise ist mir seit meinem 15. Jahr eh’ üblich (s. oben), sei’s bloß in Form von Briefen: die Schrift festigt den Gedanken, und über das mir wichtige Geschehen habe ich immer nachgedacht sowie versucht, es in Sätzen zu fassen. So mag ich in Filmbesprechungen allgemeinere oder grundlegende Betrachtungen einschmuggeln. Diesen Hang zur Theoriebildung durfte ich manchmal ganz offensichtlich frönen, z.B. für die Oberhausener Kurzfilmtage 1995 unter dem Stichwort „Industriefilmfaszination“ und für Du cinéma scientifique et technique (CinémAction 135, Herausgeber Philippe Dériaz und Nicolas Schmidt, Condé-sur Noireau 2010).
Als ich merkte, dass ich keine Angebote mehr bekam, kaum noch drehte, fing ich wieder – diesmal für die Fachpresse - zu schreiben an, es war die Wiederaufnahme einer früheren, nie ganz erloschenen Tätigkeit, ich kehrte sozusagen zu meinen Anfängen zurück. Denn, als ich versuchte, in den Filmberuf einzusteigen, gelang es mir, die Wochenzeitung „Courrier romand“ zu überzeugen, mir die Kritik der neuen Filme zu überlassen; so besprach ich knapp zwei Jahre, bis das Blatt einging, alles, worauf ich Lust hatte, und sättigte mich billigerweise mit Kinovorstellungen!
Bevor die eine journalistische Betätigung zu ende ging, bot man mir eine andere journalistische Betätigung: Sportberichterstattung aus Zürich für eine große Genfer Tageszeitung! Bei Film und Theater gab es nicht jede Woche Arbeit, aber mit drei Oberligamannschaften am Ort wurde jeden Sonntag gekickt, und im Winter Eishockey gespielt. Das sicherte mir ein kleines Einkommen. Umso mehr, dass zwei weitere Zeitungen später auch meine Dienste beanspruchten. Da viele Leser zwei dieser Blätter lasen, zwang es mich, über jedes Spiel etwas anders zu berichten – was sich als Gewinn erwiesen hat, um in Zeitschriften mit teilweise demselben Leserkreis auch über jeden Film und jedes Festival auf unterschiedlicher Weise zu schreiben. Diese Gehirngymnastik trieb ich fünf Jahre, bis sie mit meinen hauptberuflichen Beschäftigungen unvereinbar wurde.
Nach etwa zehn Jahren Schreibenthaltsamkeit aus eher privaten Gründen gab es , am Rand meiner Tätigkeit bei Theater und Film, wieder Zeitschriften- und Zeitungsbeiträge von mir, manchmal über Film, öfter über Theater, auf Deutsch wie auf Französisch. Ganz aus der Übung kam ich also nie. Bin ich dadurch zum ausgebildeten Filmjournalist geworden?